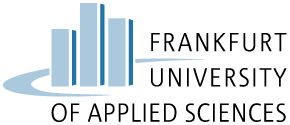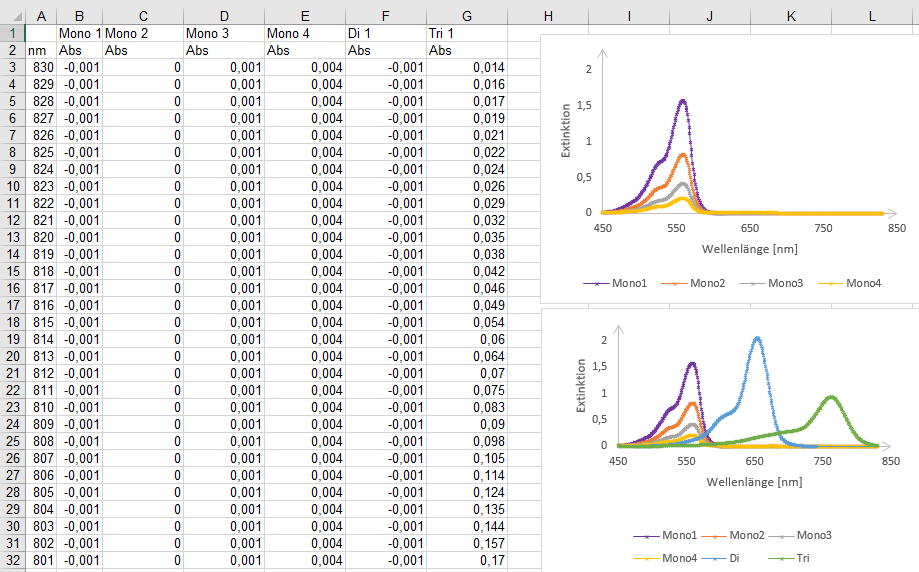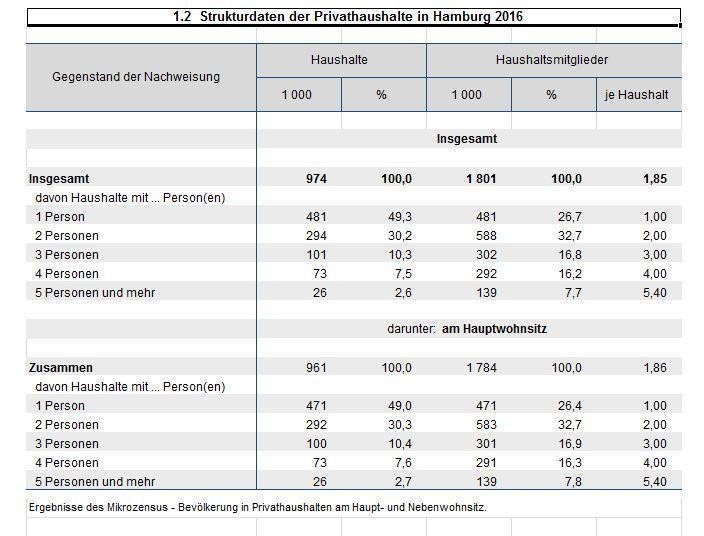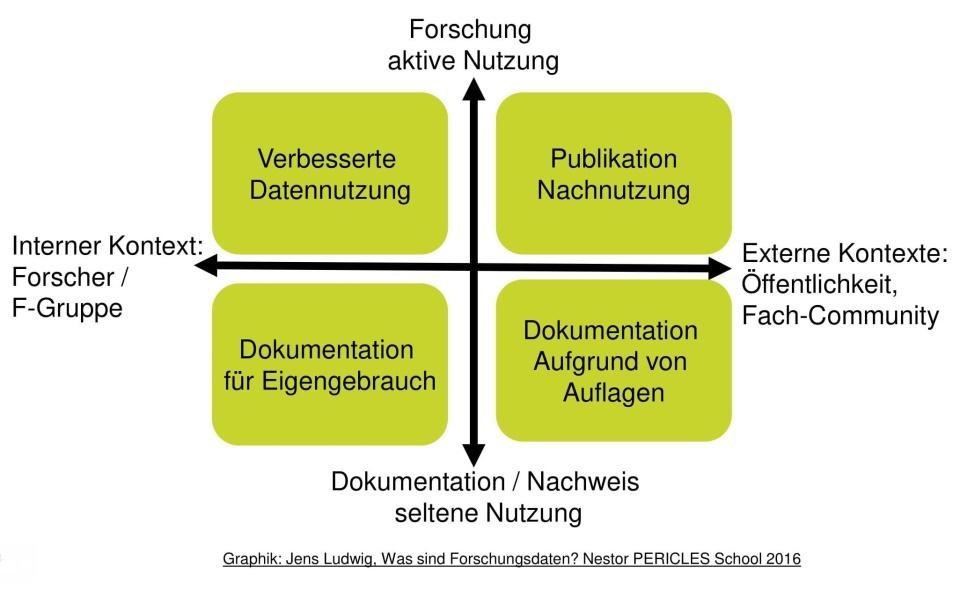1.4 Forschungsdaten und die gute wissenschaftliche Praxis
Die
„Leitlinien zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis“ der DFG
(häufig als DFG-Kodex bezeichnet) bilden für die Wissenschaft eine
gemeinsame Basis, indem sie Anforderungen an Wissenschaftlichkeit und
das gemeinsame wissenschaftliche Arbeiten stellen. Dazu gehören auch
Anforderungen an die Arbeit mit Forschungsdaten. Der DFG-Kodex besteht
aus insgesamt neunzehn Leitlinien, wobei sich die ersten sechs
Leitlinien mit wissenschaftlichen Prinzipien, die Leitlinien 7 bis 17
mit dem eigentlichen Forschungsprozess und die letzten beiden Leitlinien
mit der Nichtbeachtung der guten wissenschaftlichen Praxis
beschäftigen.
Teil der Ausführungen an dieser Stelle
sind vor allem die Leitlinien, die einen direkten Bezug zu
Forschungsdaten haben. In Leitlinie 7, „Phasenübergreifende
Qualitätssicherung“, heißt es in Bezug auf Forschungsdaten:
„Die Herkunft von im Forschungsprozess verwendeten Daten, Organismen, Materialien und Software wird kenntlich gemacht und die Nachnutzung belegt; die Originalquellen werden zitiert. Art und Umfang von im Forschungsprozess entstehenden Forschungsdaten werden beschrieben. Der Umgang mit ihnen wird, entsprechend den Vorgaben im betroffenen Fach, ausgestaltet. Der Quellcode von öffentlich zugänglicher Software muss persistent, zitierbar und dokumentiert sein. Dass Ergebnisse beziehungsweise Erkenntnisse durch andere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler repliziert beziehungsweise bestätigt werden können (beispielsweise mittels einer ausführlichen Beschreibung von Materialien und Methoden), ist – abhängig von dem betroffenen Fachgebiet – essenzieller Bestandteil der Qualitätssicherung.“ (DFG 2019, 14f, Hervorhebungen durch den Autor)
Forschungsdaten und darin eingeschlossen auch der dazugehörigen Forschungssoftware wird im Rahmen der guten wissenschaftlichen Praxis ein hoher Wert im Hinblick auf die Qualitätssicherung von Forschung zugeschrieben. Achten Sie daher darauf, dass Sie alle Arbeitsschritte so dokumentieren, dass andere Wissenschaftler eine Möglichkeit haben, Ihre Ergebnisse zu überprüfen. Dazu gehört es auch, fremde (Daten)quellen anzugeben, mit denen Sie Ihre eigenen Daten vielleicht erweitert haben.
Leitlinie 10, „Rechtliche und ethische Rahmenbedingungen, Nutzungsrechte“, weist neben dem verantwortungsvollen Umgang mit Forschungsdaten u. a. daraufhin, dass zu den rechtlichen Rahmenbedingungen eines Forschungsvorhabens auch „dokumentierte Vereinbarungen über die Nutzungsrechte an aus ihm hervorgehenden Forschungsdaten und
Forschungsergebnissen“ zählen. (DFG 2019, 16) Für Sie als Forschende heißt das, diese Vereinbarungen einzuholen und die Nutzungsrechte in den Metadatenbeschreibungen der Daten für Nachnutzende offenzulegen.
In Leitlinie 12, „Dokumentation“, fordert die DFG, dass „alle für das Zustandekommen eines Forschungsergebnisses relevanten Informationen so nachvollziehbar [dokumentiert werden], wie dies im betroffenen Fachgebiet erforderlich und angemessen ist, um das Ergebnis überprüfen und bewerten zu können.“ (DFG 2019, 17f) Um diese Nachvollziehbarkeit zu gewährleisten, ist es u. a. notwendig, dass Informationen über verwendete und über im Projektzeitraum entstehende Forschungsdaten gegeben werden, die für Dritte in einer verständlichen Form offen dargelegt sind.
Leitlinie 13, „Herstellung von öffentlichem Zugang zu Forschungsergebnissen“, fordert den Weg der Forschung hin zu Open Access, auch in Bezug auf die verwendeten Forschungsdaten. „Aus Gründen der Nachvollziehbarkeit, Anschlussfähigkeit der Forschung und Nachnutzbarkeit hinterlegen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, wann immer möglich, die der Publikation zugrundeliegenden Forschungsdaten und zentralen Materialien – den FAIR-Prinzipien („Findable, Accessible, Interoperable, Re-Usable“) folgend – zugänglich in anerkannten Archiven und Repositorien.“ (DFG 2019, 19) Die DFG weist allerdings auch ausdrücklich darauf hin, dass es in manchen Fällen auch sein kann, dass eine Open Access-Publikation der Daten nicht möglich ist (z. B. im Falle von Patentrechten Dritter). Es sollte mit Blick auf Open Access daher immer folgender Grundsatz gelten: So offen wie möglich, so geschlossen wie nötig.
Die letzte Leitlinie, die einen Bezug zu Forschungsdaten aufweist, ist Leitlinie 17, „Archivierung“. Diese fordert, dass bei der Veröffentlichung der Forschungsergebnisse, die der Publikation zugrundeliegenden Forschungsdaten „in der Regel für einen Zeitraum von zehn Jahren zugänglich und nachvollziehbar in der Einrichtung, wo sie entstanden sind, oder in standortübergreifenden Repositorien aufbewahrt“ werden. (DFG 2019, 22) Informieren Sie sich bereits vor Beginn eines Forschungsprojekts beim Forschungsdatenreferat der [Name der Hochschule] nach Möglichkeiten zur Archivierung. Vor allem, wenn es sich um ein Projekt mit sehr hohem Datenaufkommen handelt, können ggf. Gelder mitbeantragt werden, um die nötige Speicherinfrastruktur für die Archivierung sicherzustellen.
Falls Sie weitere Informationen zur guten wissenschaftlichen Praxis benötigen, lohnt sich der Besuch der Webseite Ombudsman für die Wissenschaft, einem „von der DFG eingesetzten Gremium, das allen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern in Deutschland bei Fragen und Konflikten im Bereich guter wissenschaftlicher Praxis (GWP) bzw. wissenschaftlicher Integrität zur Seite steht.“ Hier finden Sie weitere Literatur, die sich speziell mit dem Umgang mit Forschungsdaten nach guter wissenschaftlicher Praxis beschäftigt. Unter dieser Adresse finden Sie Verweise auf internationale Literatur zu sogenannten Codes of Conduct in der Wissenschaft. Dieser Artikel beschäftigt sich mit der Frage nach Kooperationen und der Gewährung eines Datenzugangs nach Abschluss eines Drittmittelprojekts, wenn sich die Forschenden womöglich nicht mehr an der Institution befinden, an der sie diese Daten erhoben haben.